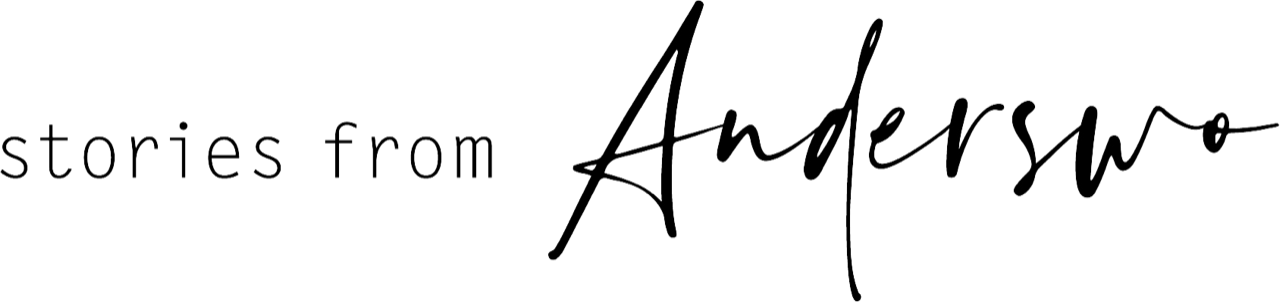Gion A. Caminada: Der Ortmacher
An einem traumhaft sonnigen Oktobertag besuchen wir den visionären Baumeister Gion A. Caminada in Vrin, seinem Heimatdorf und architektonischen Freilandlabor. Seit mehr als dreissig Jahren wirkt er hier, gestaltete Wohnhäuser, Ställe, ein Schlachthaus, eine Sägemühle, eine öffentliche Telefonzelle und natürlich seine berühmte Totenstube «Stiva da morts». Sein Werk ist geprägt von der traditionellen Strickbauweise der Region, die er immer weiterdenkt, im eigenen Stil, variiert zu moderner Architektur. Die angestammte Methode bleibt: Stamm auf Stamm, übers Eck verzahnt und verstrickt.
GEPRÄGT VOM DORF UND VOM EWIGEN HINAUFGEHEN
Die Berge und sein einfaches Leben im kleinen Bergdorf prägten Caminada als Kind und später als Mann, als Architekt, als Schweizer. «Ich bin als Bauernsohn hier aufgewachsen», erzählt er. «Die Beziehung zur Landschaft hat mich natürlich auch geprägt, meine Haltung. Dieses immerwährende Hinaufgehen. Immer Kühe. Knappheit an Ressourcen. Die Leute waren damals, als ich ganz jung war, sehr arm, und man hatte nur die Notwendigkeiten zum Leben.»
Caminada lebt mit seiner Frau Giuseppa noch immer in Vrin. Einer seiner drei erwachsenen Söhne baut Architekturmodelle für ihn, ein weiterer ist Bildhauer und der dritte geht «irgendwo Richtung Textilien», erzählt der Vater. Er finde es in Ordnung, dass keines seiner Kinder Architekt werden wolle: «Das bleibt dann mit mir stehen. So muss es sein, klar.»
LEBEN UND ERFAHRUNG IM LOKALEN
Anstatt sich über die ganze Welt den Kopf zu zerbrechen, denkt Caminada lieber lokal. Es sei das Beste, sich auf die regionalen Wurzeln und Eigenarten zu besinnen und die Welt einzuladen, sich am Spezifischen zu orientieren. «Alles Wichtige geschieht im Lokalen», sagt er.
"Mein Anspruch an Architektur ist, Nähe zu gewinnen zu den Dingen. Wir müssen wieder verstehen und darin sein".
Und die Welt kommt in das verschlafene Bergdorf, so wie wir heute, um zu sehen, wie der berühmt gewordene Bauernsohn dort mit unermüdlicher Denkkraft die traditionelle Strickbauweise neu interpretiert und so einen Ort schafft, in dem die Zeit nur scheinbar stehen geblieben ist.
Caminada sieht eine seiner Lebensaufgaben darin, sein Heimatdorf Vrin mit bedachter Architektur auch für die Zukunft lebenswert zu gestalten. Gleichzeitig reflektiert kaum ein anderer heimischer Zeitgenosse derart ehrlich über die Entwicklung des Lebensraums Schweiz – der Bergwelt ebenso wie auch des urbanen Raums.
Wenn er ein neues Projekt beginnt, holt er zunächst weiter aus, denkt über die Architektur hinaus und denkt hinüber in die Philosophie, die Kunst, das Handwerk. Erst dann zügelt er sein Sinnieren und beginnt etwas zu gestalten, was man auch bauen kann.
DIE NÄHE ZU DEN DINGEN
Hier im Lokalen kann er die Nähe zu den Dingen erfahren. Eine Nähe zu den Materialien, zu einem Ort. Diese Unmittelbarkeit sei ihm enorm wichtig. Nur so könne er Orte schaffen, die Identität stiften. Und nur so kann seine Architektur Teil des Ortes werden, mitgeprägt von den Gepflogenheiten der Dorfbewohner.
Deshalb mag er Panoramafenster nicht: «Es geht nur um ein Bild, darum, etwas zu sehen. Es ergibt keinen Sinn», hält er fest. «Es stellt sich die Frage für mich, was kommt zurück? Resonanz, das ist für uns ein unglaublich wichtiger Begriff.» Das Panorama sei für ihn dafür viel zu weit weg von den Dingen. «Mein Anspruch an Architektur ist, Nähe gewinnen zu den Dingen. Wir müssen wieder verstehen und darin sein. Dass die Landschaft schön sei, das sagt ein Bauer nicht. Das sagt nur einer, der eine distanzierte Beziehung dazu hat.» Einer eben, der die Berge durch ein Panoramafenster betrachtet.

Auf einen ihm eigenen Stil wolle er sich nicht festlegen lassen. «Es gibt keine Theorie dafür. Gute Räume schaffen, das ist eine Haltung, nicht eine Methode oder ein Thema», insistiert er. «Es gibt keine Methode, nur meinen Zugang zum guten Bauen.» Was ihn inspiriere? «Alles. Gefordert ist eine Urteilsenthaltung. Es braucht die entsprechende Wahrnehmung, und dann kann alles dich inspirieren.» Auch seine Studenten? Der Professor zögert. «Natürlich kommt von jedem etwas zurück», räumt er ein. «Wenn ich die Bereitschaft habe, etwas zu empfangen, kann ich durchs Dorf gehen und sogar von den Schafen etwas lernen.» Ob ein junger Geist wirklich so viel umwälzen kann, wie man ihm nachsagt, stellt er in Frage: «Ich denke, für Architektur muss man alt werden.»
«Es ist, wie es ist», eine Wendung, die Caminada während unseres Gesprächs immer wieder gebraucht. «Wenn man tatsächlich ganz nah dran ist an der Landschaft, ist es so, wie es ist. Sie kann schön sein, aber auch böse. Und das interessiert mich auch in der Umsetzung der Architektur.» Er erinnert sich an früher, als für die Bauern der Bezug zur Natur direkt und unmittelbar war: «Bis vor gar nicht langer Zeit gab es diesen Unterschied zwischen Natur und Kultur gar nicht.» Was im Laufe der Jahre radikal auseinanderdividiert worden sei, in Mensch, Natur, Tier, Stein, versuche er unter heutigen Bedingungen in seinen Projekten wieder zusammenzufügen.
CAMINADAS WALDHÜTTE IN EMS
Diese Wechselwirkung zwischen Natur und Mensch zu bewirken, genau darum ging es Ca- minada bei der «Tegia da vaut», einer Waldhütte südlich der Gemeinde Domat/Ems in Graubün- den: «Der Blick ist nur in den Wald gerichtet», beschreibt er. «Ich bin extrem fokussiert auf die Bäume. Plötzlich sehe ich nur die Baumstämme. Das sind so Momente, da bist du eigentlich ganz, ganz konfrontiert.
Auf der Lichtung einer kleinen Schafwiese gebaut, dient Caminadas Hütte als Bildungsstätte für Menschen in Waldberufen, sowie für Schulklassen und Gruppen. Die Baumaterialien gewann der Architekt in der unmittelbaren Umgebung. Seiner Überzeugung nach machen heimische Materialien den Kern einer differenzierten und standortspezifischen Baukultur überhaupt aus. Denn Differenz kann nur entstehen und bestehen, wenn es Abgrenzung gibt.
Aussen ist die Waldhütte in ein kurviges Schindel- gewand gekleidet. Die fast komplett verschlosse- ne Front und die Seitenwände der Hütte werden lediglich von kleinen Fenstern durchbrochen. Die zum Wald hin gerichtete Längsseite aber öffnet sich grosszügig zu den Bäumen hin.
Fenster fassen den Blick derart ein, dass man nur einen Wald von Baumstämmen sieht. Die Natur aus der Nähe, so wie sie ist. Durch gutes Handwerk den Eigenschaften des Holzes Ausdruck zu geben, spielte von Anfang an eine grosse Rolle. Die weiche Oberfläche derWeisstanne schluckt Geräusche, wodurch sogar die gedämpfte Akustik drinnen der eines Waldes ähnelt. Das Material erhielt seinen angestammten Platz im Wald zurück.
DIE NÄHE ZUR SCHAFWOLLE
Auch Schafwolle verwendete Caminada beim Emser Projekt, für die Wärmedämmung und die Akustik: An der Decke lassen dünne, ineinander verwobene Holzstreifen Quadrate frei, durch die eine flauschige Schicht Schafwolle sichtbar wird. «Man sieht die Schafwolle an der Decke eins zu eins», sagt der Architekt. «Das Material hat eine Schönheit, das ist ein einfaches Beispiel, dort ging es sehr gut in dieser Waldhütte.»
Die Nähe zum Material, die dem Architekten so viel bedeutet, kann er bei Schweizer Schafwolle ganz besonders spüren. «Wunderbare Akustik, wunderbares Material, das raumwirksam ist», beteuert Caminada. «Ich denke, das ist eine spannende Nische.» Gern würde er gemeinsam mit Swisswool Produkte aus Schafschurwolle erarbeiten, sagt er: «Man müsste schauen, dass es gut einsetzbar ist, meiner architektonischen Vorstellung entspricht.» Schafwolle sei ein unvergleichliches, natürliches Material für die Isolation, das man auch in Sicht lassen könne, weil es einfach schön sei. «Diese alchimistische Vorstellung, gerade die Veredlung eines bestimmten Materials, eines bestimmten Produktes, das ist schon interessant», führt er aus. Schafwolle stehe für ihn exemplarisch für das lokale Bauen. «Lokales Bauen heisst für mich nicht nur, das zu nehmen, was hier ist, sondern die Intensität, die drinnen steckt in diesen Dingen. Wie intensiv gehst du mit dem um?»
ORTE SCHAFFEN IDENTITÄT
Um Nähe zu einem Material wie Schafwolle zu gewinnen, müsse er vor allem die Eigenschaften kennen. Was kann Schafwolle, was nicht? «Das muss man irgendwie erfahren», sagt er. Man könne nur identitätsstiftende Orte schaffen, wenn Produkte vor Ort hergestellt werden und dabei das Handwerk herausgefordert wird. Dadurch wird lokales Wissen aufgebaut, und es entsteht eine Bedeutung für die Bewohner vor Ort.
Das Lokale ist im Kern Differenz: «Etwas Wertvolles für mich in der Welt sind Differenzen. Die Fokussierung auf Schafwolle, auf Besonderheiten, die irgendwo an einem bestimmten Ort hergestellt werden», sagt der renommierte Baumeister. «Differenzen schaffen heisst für mich auch, die starken Identitäten oder die besondere Wirkung einer bestimmten Situation zum Ausdruck zu bringen oder zu stärken.»
ERFAHRUNG VRIN: DIFFERENZ BRAUCHT DAS FAST-GLEICHE
Wir sitzen in einer kleinen Kammer im Obergeschoss des Alten Schulhauses in Vrin, wo sich Caminada sein Atelier eingerichtet hat. Er zeigt aus dem Fenster hinter sich. Von hier sieht er das ganze Dorf: «Das ist kein schlechtes Bild, oder?», fragt er, freilich rhetorisch. «Ich wollte nie einen Kontrast. Wenn ich jetzt einen Glaskasten da hineinsetzen würde, dann wäre das Dorf kaputt. Die Homogenität ist kaputt. Das ist eine ganz klare Hierarchie, mit der Kirche und den Häusern drumherum, das erträgt unglaublich vieles. Ich möchte eigentlich am Bestand weiterarbeiten, diese Kraft, diese Wirkung, die vorhanden ist, soll weiterhin Ausdruck bekommen.»
Das kontinuierliche Weiterdenken und Weitertragen mag er in seiner Arbeit. Eine seiner Gestaltungsthesen für das Dorf besagt, wie Bedeutung durch Verschiedenheit geschaffen werden kann: «Damit Differenz eine Wirkung hat, als das Spezifische in Vrin, braucht es ein gewisses Quantum des Fast-Gleichen. Die Dinge sind fast gleich, aber nicht kongruent.»
Viele moderne Architekten im alpinen Raum wählen den Kontrast zwischen modernem Design und der bestehenden traditionellen Dorfarchitektur, um etwa ein herausragendes Statement in Beton und Glas zu erschaffen. Für Caminada sind das Alte und das Neue, das Traditionelle und das Moderne Gegensätze, die keine sind. «Man braucht das Alte, oder vielmehr die Reflexion auf das Alte, um die Werte weiterzutragen», erklärt er. «Es geht immer um die Gegenwart, um den Augenblick. Aber das schliesst ja das Vergangene nicht aus. Ich möchte nicht Alt und Neu gegenüberstellen, programmatisch. Damit hat man viele Dörfer zerstört.»
Auf einen ihm eigenen Stil wolle er sich nicht festlegen lassen. «Es gibt keine Theorie dafür. Gute Räume schaffen, das ist eine Haltung, nicht eine Methode oder ein Thema», insistiert er. «Es gibt keine Methode, nur meinen Zugang zum guten Bauen.» Was ihn inspiriere? «Alles. Gefordert ist eine Urteilsenthaltung. Es braucht die entsprechende Wahrnehmung, und dann kann alles dich inspirieren.» Auch seine Studenten? Der Professor zögert. «Natürlich kommt von jedem etwas zurück», räumt er ein. «Wenn ich die Bereitschaft habe, etwas zu empfangen, kann ich durchs Dorf gehen und sogar von den Schafen etwas lernen.» Ob ein junger Geist wirklich so viel umwälzen kann, wie man ihm nachsagt, stellt er in Frage: «Ich denke, für Architektur muss man alt werden.»